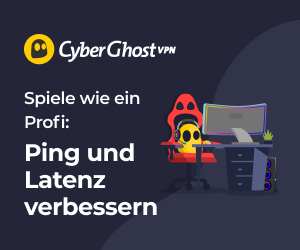Inhaltsverzeichnis
Aufgrund unterschiedlicher Ereignisse, Themenkomplexe und gesellschaftlicher Entwicklungen ist E-Sport immer mehr in aller Munde. Die Digitalisierung etwa ist ein Themenfeld, das durch den elektronischen Sport offengelegt und vermittelt werden kann. Ein anderes Beispiel ist die Coronapandemie, die gerade dem traditionellen Sport deutlich gemacht hat, welche Chancen im E-Sport stecken, da er aufgrund seines virtuellen Charakters quasi immer betrieben werden kann.
E-Sport wächst und gilt vielen inzwischen nicht mehr als Markt mit nerdigen, übergewichtigen Energydrink-Konsumenten, sondern als das, was er ist: ein Chancenmarkt mit einer sehr heterogenen Szene. Gleichzeitig transportiert die E-Sport-Szene aber auch etwas nach außen, das sie im negativen Sinne auszeichnet: Eine Überhöhung.
Die Ausgangslage
Angefangen hat Mitte der 1990er Jahre alles sehr klein. Erst im Regionalen, wenig später deutschlandweit, wurden Clans gegründet, also erste E-Sport-Organisationen. Namen wie OCRANA, TAMM oder pro-Gaming kennen heute die wenigsten. Dennoch wäre gerade der deutsche E-Sport ohne diese Wegbereiter lange nicht das, was er heute ist. Andere alte Organisationen gibt es bis heute, SK Gaming und mousesports etwa. Mit der ESL wurde darüber hinaus im Jahre 2000 eine Liga gegründet, die heute der größte Wettbewerbsveranstalter der Welt ist.
Aus einer kleinen Gruppe von Hobbyisten und sogenannten „Pro Gamern“ erwuchs nach und nach eine immer größer werdende Szene. Inzwischen betreiben weltweit viele Millionen Menschen E-Sport. Häufig im Bereich des Breiten- und Amateursports.
Die Zeichen stehen auf Wachstum
Im Jahr 2018 hatte der globale E-Sport ein Marktvolumen von 776 Millionen US-Dollar. Aktuelle Prognosen sehen E-Sport 2023 bei einer Größe von rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Das entspräche einer Verdopplung des Marktes innerhalb von sechs Jahren. Klingt gut, oder? Ist es auch, keine Frage. Das exponentielle Wachstum des E-Sport-Marktes hat diesem viel Aufmerksamkeit verschafft. Nicht nur in den Medien oder der Politik, sondern in quasi allen gesellschaftlichen Bereichen. Es gibt E-Sport-Studiengänge, Bücher, Maßnahmen im Bereich Employer Branding, Agenturen, Beratungsgesellschaften, Vereinsheime, E-Sport-Zentren und so weiter. Das ist eine großartige Entwicklung.
Ihr merkt an der Formulierung bestimmt: Da kommt ein „Aber“. Und ja, E-Sport hatte schon immer, seit ich denken kann, eine unschöne Angewohnheit, nämlich sich selbst größer zu machen als er ist.
Überzeichnung
Wer einmal im E-Sport recherchiert, gerade als Neuling, der wird feststellen, dass es im E-Sport viele Menschen gibt, die schön klingende Titel führen, die sie sich zumeist selbst gegeben haben: Chief Executive Officer (CEO), Chief [irgendetwas anderes] Officer, Präsident, Vizepräsident und so weiter. Ich komme hauptberuflich aus dem Personalbereich. Meine Aufgabe ist es daher Menschen zu „scannen“. Gleiches gilt für andere „Personaler“. Ein befreundeter Kollege hat mich einmal auf eben jenen Fakt angesprochen, warum es im E-Sport mehr Führungskräfte als Mitarbeiter zu geben scheint. Diese Überzeichnung von Positionen ist also nicht nur unprofessionell, sondern sie fällt auch außerhalb der Szene inzwischen deutlich auf.
Ferner wird E-Sport als „Boommarkt“ beschrieben. Das ist er gewissermaßen auch. Ich erinnere mich aber auch an andere „Boommärkte“, die derartig in den Himmel gehoben worden sind, ohne entsprechendes Fleisch auf den Knochen zu haben. Die Internetblase der 2000er Jahre zum Beispiel oder der US-amerikanische Immobilienmarkt. Während E-Sport als einer der Zukunftsmärkte gilt, was er bei einem vernünftigen Vorgehen sicher auch sein kann, ist er nämlich weit davon entfernt schon groß zu sein.
Vielleicht, um beides anhand des vorhandenen Zahlenwerkes an einem Beispiel deutlich zu machen. Nehmen wir einmal ein Unternehmen, das wirklich groß ist. Siemens ist hier ein gutes Beispiel, weil das Unternehmen global agiert und zu den Spitzenreitern seiner Branche gehört. Das Unternehmen hatte im letzten Jahr einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro, was ungefähr 67,4 Milliarden US-Dollar entspricht. Das bedeutet, dass Siemens, also ein einziges Unternehmen, 45-mal größer ist, als es der gesamte E-Sport-Markt weltweit im Jahre 2023 sein wird. Wisst ihr wie viele CEOs Siemens hat? Genau: Einen.
Jetzt könnte man anführen, dass es unfair ist, dass ich mit Siemens einen der ganz großen Player im internationalen Geschäft gewählt habe. Schauen wir uns also gerne auch einmal den Mittelstand an. Die Steag GmbH ist ein gutes Beispiel. Kennen wahrscheinlich die wenigsten, weil Steag der fünftgrößte Energiekonzern Deutschlands ist – und der Energiemarkt prinzipiell unter den „vier Großen“ aufgeteilt ist. Das Unternehmen erwirtschaftet pro Jahr rund 2,1 Milliarden Euro respektive knapp 2,5 Milliarden US-Dollar. Bedeutet: Steag ist 2,5-mal so groß, wie der globale E-Sport-Markt aktuell ist. Der weltweite E-Sport-Markt ist also kleiner, und wird es auch in 2023 sein, als ein einziges deutsches, mittelständisches Unternehmen. Wisst ihr wie viele CEOs Steag hat? Gar keinen, sondern einen Geschäftsführer beziehungsweise einen Vorsitzenden der Geschäftsführung. Bei dem genannten Beispiel handelt es sich nämlich um eine GmbH und eigentlich, ursprünglich, haben nur Aktiengesellschaften einen CEO, der nämlich der Vorstandsvorsitzende ist.
Auch in Sachen Employability sollte man sich hier Gedanken machen, wenn man hauptberuflich im E-Sport unterwegs sein möchte. Denn die geringe Größe des Marktes bietet (noch) wenig Chancen auf Vollzeitstellen, insbesondere für gut ausgebildete Menschen. Steag etwa hat knapp 6.400 Mitarbeiter. Rechnet man das, etwas unsauber, auf den E-Sport-Markt um und gehen wir davon aus, dass alle Mitarbeiter bei Steag in Vollzeit arbeiten (also 1,0 Vollzeitköpfe sind), entspräche das 2.560 Vollzeitstellen im E-Sport – weltweit wohlgemerkt.
Fazit
Der E-Sport ist grundsätzlich auf einem guten Weg. Wichtig sind hier vor allem drei Punkte, wenn man gesund wachsen möchte: Nachhaltigkeit, Glaubwürdigkeit und Realismus. Ersteres ist wichtig, um keine Blase entstehen zu lassen, die dann platzt. Ich habe oben im Beitrag Beispiele von geplatzten Blasen genannt. Zweiteres ist wichtig, um auch außerhalb des eigentlichen Marktes Fuß fassen und ehrliche Partnerschaften generieren zu können. Der dritte Punkt sollte vor allem in den Markt hineinwirken, um realistische Abschätzungen, Zielsetzungen und Prognosen sowie daraus resultierend Ableitungen treffen zu können.
Weniger Blendertum täte dem E-Sport an der einen oder anderen Stelle sehr gut. Denn die Wahrnehmung des E-Sports außerhalb des eigentlichen Marktes bessert sich zusehends. Es gilt nun die sich bietenden Chancen nicht zu verspielen. Chancen, die groß sind, aber eben nicht so groß, wie häufig dargestellt wird.